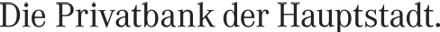Die Brücke nach Amerika
Die USA sind ein zerrissenes Land – ein Bild, das auch die diesjährigen Präsidentschaftswahlen prägt. Trotz allem sind die Vereinigten Staaten immer noch Handelsriese und kultureller Leuchtturm. Über Chancen und Potenziale im deutsch-amerikanischen Verhältnis.
Die USA sind ein zerrissenes Land – ein Bild, das auch die diesjährigen Präsidentschaftswahlen prägt. Trotz allem sind die Vereinigten Staaten immer noch Handelsriese und kultureller Leuchtturm. Über Chancen und Potenziale im deutsch-amerikanischen Verhältnis.
Text: Philipp Wurm, Foto: Philippe Gauthier / Unsplash, Erscheinungsdatum: 30. Oktober 2020
Der Arbeitsplatz, der Symbol der transatlantischen Beziehungen ist, befindet sich im 24. Stockwerk eines repräsentativen Wolkenkratzers. Dort, mitten in Manhattan, ein paar Blocks von der Wall Street entfernt, hat Berlins Senatsregierung einen Brückenkopf eingerichtet. „Berlin Business Office“ heißt die Niederlassung; in diesem Büro wirbt die Amerikanerin Kristina Garcia für die Anziehungskraft von Firmen, die an der Spree angesiedelt sind – gegenüber Repräsentanten der US-Wirtschaft. Mittelständlern und Start-ups will sie auf diese Weise zum Sprung ins Fahrwasser der amerikanischen Geschäftswelt verhelfen. Kunden und Kooperationspartner vermittelt die Netzwerkerin den Novizen beispielsweise. Ihr Auftraggeber: Berlins Wirtschaftssenat mit Sitz in Schöneberg, geleitet von der Grünenpolitikerin Ramona Pop. Sie habe eine Passion für Berlin, sagte Garcia einmal, eine globale Nomadin mit Faible fürs Leben in Deutschland. An ihrer Schaltzentrale vor der Skyline New Yorks ist sie bereits mit dem Berliner Stadtbären am Revers gesichtet worden. In Erlangen hat sie in den Achtzigern Literatur und Geschichte studiert, heute ist sie eine Generalistin, die das Verhältnis zwischen amerikanischen und deutschen Geschäftsleuten vertieft. 2019 eröffnete der Senat den Außenposten in New York. Die Dependance ist nur ein Knotenpunkt im dichten Geflecht zwischen Entscheidungsträgern dies- und jenseits des Atlantiks. Die noch junge Geschichte des „Berlin Business Office“ ist bezeichnend: dafür, dass die USA und Deutschland weiter ein lebhaftes Gespann im internationalen Handel bilden, trotz Coronapandemie und durchwachsener Wirtschaftslage. Und trotz der Legislaturperiode eines Präsidenten, der mit einer ungestümen „America First“-Politik viele Volksvertreter in Berlin beunruhigt hat, ob Bundesregierung oder Lokalpolitiker.
In diesem Sommer war das Verhältnis zu den USA mehr denn je in den Fokus gerückt – aus aktuellen Gründen. Denn der politische Status quo vor dem Hintergrund der dortigen Präsidentschaftswahlen brachte eine zerklüftete Gesellschaft zum Vorschein. Im Machtkampf zwischen Donald Trump, dem Amtsinhaber, und seinem Herausforderer Joe Biden spiegeln sich zentrale Konflikte des 21. Jahrhunderts. Es geht um Teilhabe und soziale Gerechtigkeit. Die Polarisierung zwischen den politischen Lagern mündet in Spannungen, sogar gewalttätigen Auseinandersetzungen. Bürgerrechtler, darunter Schwarze, Latinos und junge Weiße, demonstrieren gegen Rassismus und Polizeigewalt; Trump und seine Regierung kontern die Proteste mit sicherheitspolitischen Muskelspielen – und einer dämonisierenden Kampagne. Soziale Schieflagen verschärfen die Situation, darunter eine Arbeitslosenquote in Höhe von zehn Prozent.
Das Ansehen der vereinigten Staaten in Deutschland ist gesunken. Laut einer Umfrage der Körber-Stiftung bewerten 73 Prozent der Deutschen das derzeitige Verhältnis zum Geburtsland Abraham Lincolns, Franklin D. Roosevelts und John F. Kennedys als „schlecht“ oder „sehr schlecht“. Eine Beziehungskrise in der Liaison mit einer Ordnungsmacht, die einst das in tiefe Schuld verstrickte Nachkriegsdeutschland zu entnazifizieren versuchte, jenseits der sowjetischen Besatzungszone eine Demokratie etablierte und mittels Marshallplan das Wirtschaftswunder ermöglichte. Doch die Distanzierung, die Demoskopen festgestellt haben, ist nur ein Stimmungsbild. Die gesellschaftliche Wirklichkeit erscheint facettenreicher. „Die USA sind und bleiben der wichtigste Partner für Deutschland außerhalb Europas“, sagen unisono die zwei Chefstrategen im Regierungsviertel in Berlin-Mitte, Kanzlerin Angela Merkel, CDU, und ihr Außenminister Heiko Maas, SPD.
Ein Treuebekenntnis, das auch in einer kulturellen Nähe zum Sehnsuchtsland zwischen Long Island und L. A., Nebraska und New Orleans wurzelt. Die junge Merkel etwa begeisterte sich, als sie zu DDR-Zeiten ein Teenager war, für Bluejeans und träumte von der Weite der amerikanischen Landschaft. Die jungen Generationen in Westdeutschland sind sogar unmittelbar mit den Insignien des American Way of Life groß geworden, die Babyboomer mit Mickymaus und Coca-Cola, die nachfolgenden Jahrgänge mit weiteren Importschlagern – in den Achtzigern mit Madonna, Pop-Art und Walkman, in den Neunzigern mit Rap und Nike-Schuhen.
Eine weitere Seilschaft: die 200 Städtepartnerschaften zwischen Kommunen hüben und drüben – ob zwischen Mainz und Louisville oder München und Cincinnati. Und noch 2019, im Jahr vor der Ausbreitung des Coronavirus, haben die Deutschen die USA zum liebsten Reiseziel erklärt. So wie früher die in die Ferne schweifende Angela Merkel. Ein Treiber dieser Identifikation ist auch der Transfer von Produkten, Dienstleistungen und schöpferischen Ideen. Eine Konstante, die wirtschaftliche Kennzahlen belegen. Im US Außenhandel etwa rangiert Deutschland immer noch in der Top Ten der bedeutendsten Absatzmärkte. Deutsche Unternehmen wiederum liefern in kein anderes Land außerhalb Europas so ausgiebig wie in die USA: 8,7 Prozent aller Exporte werden dorthin verfrachtet. So eng sind die Bande, dass Konzerne in einzelnen US-Bundesstaaten etliche Niederlassungen betreiben, wie Mercedes, Siemens und T-Mobile, in deren Fabriken und Filialen mehr als 100 000 Menschen beschäftigt sind. Ein wichtiger Umschlagplatz ist auch Berlin. Allein 2017 verkauften Firmen aus der Hauptstadt Waren im Wert von rund 1,7 Milliarden Euro in die USA. Zwar ein leichtes Minus im Vergleich zum Vorjahr, aber in Summe immer noch fast doppelt so hoch wie die Exportbilanz in den Handelsbeziehungen mit China. In die Produktpalette aus Berlin gruppierten sich beispielsweise medizinische Geräte, entwickelt von der Firma Biotronik, deren Zentrale sich in Neukölln befindet. Oder Lebensmittel von Storck, dem Süßwarenspezialisten mit Hauptsitz in Reinickendorf, den man wegen seiner Produkte „Toffifee“ oder „Nimm 2“ kennt. Verkaufsschlager sind auch Medikamente von Bayer, jenem Pharmahersteller, der einen Sitz im alten Schering-Haus im Wedding unterhält.
Berlin pflege darüber hinaus gute politische und wirtschaftliche Beziehungen zu den Metropolen New York, San Francisco und Los Angeles, berichtet die Industrie- und Handelskammer. „Die Verstetigung der Beziehungen zu diesen und weiteren Metropolregionen gewinnt an Bedeutung in Hinblick auf die politischen Erosionen“, heißt es dort. Der hemmende Protektionismus im Außenhandel, verfügt von der Trump-Regierung, konnte Tandems jenseits des Oval Office bisher nicht entzweien. Seit 2018 erheben amerikanische Behörden bekanntlich Zölle auf Stahl und Aluminium. Die EU quittierte die Maßnahme mit Abgaben auf umsatzstarke Güter aus den Vereinigten Staaten, etwa Whiskey und Motorräder. Eine Dynamik, die Trumps Wirtschaftsstab losgetreten hat – doch hinter den Kulissen haben Gesandte aus Washington und Brüssel zuletzt wieder den Dialog gesucht. So hatte die EU vor Kurzem die Erhebung von Zöllen auf Hummer aus amerikanischen Fischereien zurückgenommen. Im Gegenzug haben die USA die Höhe von Sonderabgaben auf Zigarettenanzünder oder einzelne Fertiggerichte halbiert. Zuvor hatten US-Repräsentanten bereits Zölle auf griechischen Käse und Kekse aus Großbritannien zurückgenommen – dafür allerdings eine Sonderabgabe auf deutsche Marmelade erhoben, fällig seit dem 1. September. Der Grund für das Gezerre um die Ein- und Ausfuhr von Produkten, die in Supermärkten, Discountern und Malls ausliegen, reicht übrigens über strammen Protektionismus hinaus. Die EU hatte in der Vergangenheit an den europäischen Flugzeugbauer Airbus rechtswidrige Subventionen gezahlt. Die Welthandelsorganisation WTO gewährte daraufhin den USA die Erhebung von Strafzöllen in Höhe von 7,5 Milliarden Euro.
Ein Wind of Change im Handelsstreit w.re ein wichtiger Impuls für Geschäftsklima und Arbeitsmärkte in Zeiten der Pandemie. Branchenvertreter aus den USA und Deutschland würden davon profitieren. Und damit auch ein Kontakthof wie das „Berlin Business Office“ in New York. Ebenso wertvoll wäre der diplomatische Gewinn: die Pflege des reichhaltigen Erbes der transatlantischen Beziehungen.
Diesen Beitrag lesen Sie auch in unserem Magazin diskurs Nr. 32. Bestellen Sie ein kostenloses Exemplar bei Roland Lis, Berater Privatkunden, Weberbank Actiengesellschaft, Tel.: (030) 897 98 – 403, E-Mail: roland.lis@weberbank.de