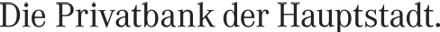Investieren in Bunt
Die Start-up-Kultur in Deutschland und insbesondere in Berlin wird internationaler und diverser. Doch noch müssen Gründer mit Migrationsbiografie mehr Hindernisse überwinden als ihre deutschen Mitstreiter. Vorbilder aus der Szene setzen sich dafür ein, die Hürden abzubauen.
Die Start-up-Kultur in Deutschland und insbesondere in Berlin wird internationaler und diverser. Doch noch müssen Gründer mit Migrationsbiografie mehr Hindernisse überwinden als ihre deutschen Mitstreiter. Vorbilder aus der Szene setzen sich dafür ein, die Hürden abzubauen.
Text: Sabine Hoelper, Foto: Julian Hochgesang / Unsplash
Sophie Chung ist in Wien geboren. Ihre Eltern waren Ende der Siebzigerjahre als kambodschanische Flüchtlinge nach Österreich gekommen. 2011 ging Chung nach Deutschland und später für drei Jahre nach New York. 2016 gründete sie, nach Berlin zurückgekehrt, die E-Health-Plattform Qunomedical. Das Start-up beschäftigt mittlerweile 70 Mitarbeiter aus 25 Nationen. Die Medizinerin hat bereits vier Finanzierungsrunden abgeschlossen, insgesamt investierten die Kapitalgeber einen unteren zweistelligen Millionenbetrag. „Das Unternehmen wächst und gedeiht“, sagt Chung. Qunomedical ist eines von vielen erfolgreichen deutschen Start-ups, die von Menschen mit internationalem Hintergrund gegründet wurden. Weitere Beispiele sind Biontech, Auto1, ResearchGate, Get Your- Guide oder Gorillas. Doch das sind nur die bekannten Namen, die Zahl der Gründer mit Migrationsgeschichte ist weitaus größer. Laut dem aktuellen Report „Migrant Founders“, herausgegeben vom Bundesverband Deutsche Startups und der Friedrich-Naumann-Stiftung, beträgt ihr Anteil hierzulande rund 20 Prozent, Tendenz steigend. Denn die Start-ups der migrantischen Gründer befänden sich häufiger in einer frühen Entwicklungsphase, was auf eine zunehmende internationale Anziehungskraft von Hotspots wie Berlin hinweise, so die Umfrage.
Das wertet auch Christoph J. Stresing, Geschäftsführer beim Bundesverband Deutsche Startups, als Erfolg. „‚Migrant Founders‘ nehmen eine wichtige Rolle im Start-up-Ökosystem ein“, betont er. Die Kehrseite der Medaille ist, dass dieser Erfolg besonders hart erarbeitet wurde. Den Gründern liegen mehr Steine im Weg als ihren „biodeutschen“ Mitstreitern. Und so bilanziert Stresing trotz der recht hohen Quote: „Da ist noch Luft nach oben. Es wäre wünschenswert, mehr talentierte Menschen mit internationaler Herkunft für eine Gründung zu gewinnen.“ Deshalb kommen in der Umfrage seines Verbands Vorbilder zu Wort, die mehr Menschen animieren sollen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Stresing: „Es ist wichtig, die vorhandenen Gründer sichtbar zu machen und Diversität als Erfolgsfaktor herauszustellen.“ Chung bestätigt das. „Nur mit einem diversen Team können wir ein gutes digitales Produkt für die Welt bauen“, sagt die Medizinerin.
Außerdem zeigt der Report, welche Bedeutung Gründerinnen und Gründer mit Migrationsbiografie haben und welche Besonderheiten sie aufweisen. Die zentralen Aussagen: Mit einem Anteil von gut 20 Prozent sind Gründer mit ausländischen Wurzeln eine treibende Kraft wirtschaftlicher Innovation in Deutschland. Allerdings variiert das Verhältnis von Bundesland zu Bundesland. Am stärksten vertreten sind Migrant Founders mit 26,6 Prozent in Nordrhein-Westfalen, auf Platz zwei liegt Berlin mit 21,2 Prozent. Die Schlusslichter sind alle ostdeutschen Bundesländer sowie das Saarland. In diesen Regionen liegen die Anteile bei unter einem Prozent. Interessant sind auch diese Ergebnisse: 91 Prozent der Gründer mit Migrationserfahrung haben einen akademischen Abschluss – gegenüber 84 Prozent in der gesamten Start-up-Szene. Auch die Risikobereitschaft der Migranten liegt höher, sie streben eher einen Exit an. „Diese Impulse sind entscheidend, wenn es darum geht, zunehmend größere Unternehmen aus dem Start-up-Sektor zu entwickeln“, heißt es in der Studie. Warum die Risikobereitschaft derer, die hierherkommen, höher ist, erklärt Tamaz Georgadze, Gründer der Sparplattform Raisin: „Wer hier keine Wurzeln hat, also auch kein Erbe, muss sich seinen Weg zum Erfolg erarbeiten, muss selbst etwas aufbauen. Der hat einfach mehr Hunger.“
Georgadze passt selbst perfekt in das Bild des Risikobereiten und besonders gut ausgebildeten Gründers ausländischer Herkunft. Er kommt aus Georgien, dort galt er als Wunderkind. Er übersprang mehrere Schulklassen, schon im Alter von vier, fünf Jahren bezwang er Erwachsene im Schach. Mit zwölf machte er Abitur, mit 15 schloss er sein erstes Studium ab, zwei Doktorgrade folgten. Es mag seiner hohen Intelligenz geschuldet sein, seinen guten Deutschkenntnissen, seiner Art, Probleme nicht überzubewerten, sondern vielmehr Chancen zu sehen und wahrzunehmen, dass der Unternehmer ausschließlich positiv über seine Erfahrungen spricht. „Ich persönlich habe die Gründung meiner Firma nicht als besonders schwierig angesehen“, sagt der 43-Jährige. Er verstehe aber, dass gründungswillige Ausländer, die noch in ihrem Heimatland leben, hierzulande zu viele Hemmnisse sehen und sich daher bei der Abwägung, ob sie in Deutschland ein Startup aufbauen wollen, dagegen entscheiden. „Ein Russe kann genauso gut in London oder sonst wo gründen. Also vergleicht er die Standorte und entscheidet sich für den in seinen Augen besten.“
Nun ist Deutschland nicht für jeden der beste Standort. Zumindest anfangs nicht der leichteste. Für Fabiola Munguia zum Beispiel. Im Alter von 18 Jahren verließ sie ihr Heimatland El Salvador und zog nach Deutschland. Ganz allein hat sie diesen Schritt gewagt. Munguia studierte, arbeitete bei Konzernen wie VW, BMW und Siemens. 2020 gründete sie – auch weil sie aus einer Unternehmerfamilie stammt und Selbstständigkeit schon länger ihr Ziel war – gemeinsam mit ihrem früheren Kommilitonen Grigory Emelianov ein Start-up im Segment Cyberkriminalitätsabwehr. Damals unter dem Namen Requestee, inzwischen firmiert es als Secfix, und bereits anderthalb Jahre nach Gründung stehen alle Zeichen auf Wachstum. Im Spätsommer konnte das Unternehmen mit zehn Mitarbeitern die erste Finanzierungsrunde abschließen. Mehrere Business Angels haben in Secfix investiert.
Munguias Geschichte ist eine Erfolgsstory. Eine Migrantin, gerade mal 27 Jahre alt, reüssiert als Gründerin. Das Handelsblatt hat sie im März dieses Jahres als eine von „100 Frauen, die dieses Land in den nächsten Jahren voranbringen werden“, vorgestellt. Aber: Ihre Gründung war ein schwieriger Ritt durch die Institutionen. Es gab viele Hindernisse. Hindernisse, die daraus resultierten, dass sie einen Migrationshintergrund hat. „Die bürokratischen Hürden sind für Leute wie mich hoch“, sagt Munguia, die neben der salvadorianischen die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt. Sie erzählt von Visumproblemen und der Schwierigkeit, ein Geschäftskonto zu eröffnen. „Von der Idee zu gründen bis zur Realisierung haben wir acht Monate gebraucht“, sagt sie. Auch Alina Bassi gibt der migrantischen Gründerszene ein Gesicht – und zeigt, dass Personen mit nicht weißer Hautfarbe in Deutschland Chancen haben. 2018 kam Bassi mit ihrem Ehemann nach Berlin, 2019 gründete sie Kleiderly. Das Start-up stellt Sonnenbrillen aus recycelten Textilien her. Aufgewachsen ist die 31-Jährige in London, ihre Wurzeln liegen in Indien und Ostafrika. Die Ingenieurin weist – trotz eines recht guten Starts – auf die Herausforderungen hin. „Im Vereinigten Königreich gründet man in fünf Minuten eine Firma“, sagt Bassi. Hier empfand sie schon die große Zahl an möglichen Rechtsformen als kompliziert. Immerhin, sagt sie, „kam ich noch vor dem Brexit, also als EU-Bürgerin, nach Deutschland. Zumindest brauchte ich kein Visum“.
Ein weiteres Problem sei, so Bassi, dass man am Anfang allein dastehe, keine Freunde, kein Netzwerk von Gleichgesinnten habe. Sie hat sich daher der Factory Berlin angeschlossen, einem Inkubator, dem 150 Start-ups aus mehr als 70 Nationen angehören. Denn gerade Netzwerke sind wichtig, wenn ein Gründer vorankommen will, für Kontakte zu Geldgebern etwa. Genau hier aber sind die entscheidenden Schwachstellen. Laut „Migrant Founders Report“ liegen die Probleme insbesondere in den Bereichen Finanzierung, Vernetzung und Kooperation. Migrant Founders erhielten, so die Befragung, im Schnitt 1,1 Millionen Euro externes Kapital gegenüber 2,6 Millionen in der Gesamtheit. Ebenso sind bürokratische Hürden festzustellen. Aus mehreren Gesprächen mit den Gründern in der Factory weiß Graeme du Plessis, Head of Brand & Community des Inkubators: „Die Bürokratie erschwert es vielen, ein Start-up zu gründen. Besonders schwierig ist es für Migrant Founders, die noch dabei sind, die deutsche Sprache zu lernen oder sich in Deutschland einzuleben.“ Auch Bassi realisierte diese Nachteile recht schnell. Sie besuchte viele Events, um sich einzubringen. Und stets stellte sie fest: „Außer mir war kaum eine nicht weiße Frau anwesend.“ Sie suchte daraufhin nach Gruppen, die farbige Frauen repräsentieren, ber wurde nicht fündig. Also tat sich Bassi mit zwei Mitstreiterinnen zusammen und gründete die Plattform Founderland. Bereits nach wenigen Monaten gelang es ihnen, Migrantinnen mit Geldgebern zusammenzubringen. Eine der Profiteurinnen könnte Fabiola Munguia von Secfix sein. In der kürzlich abgeschlossenen ersten Finanzierungsrunde kam ihr Eintritt bei Founderland zu spät. Aber für eine anvisierte zweite Runde erscheint ihr die Gemeinschaft als hilfreich.
Samuli Sirén, Gründer der Redstone Digital GmbH in Berlin, kann das Engagement nachvollziehen. Er selbst, vor 27 Jahren aus Finnland nach Berlin eingewandert und seit gut sieben Jahren als Venturecapital-Geber aktiv, agiert zwar vorurteilsfrei: „Ich stelle aussichtsreiche Geschäftsideen immer vor alles andere wie etwa die Herkunft des Gründers“, sagt er. Und doch weiß er aus seinen Erfahrungen, dass es auch im 21. Jahrhundert für Gründer und Gründerinnen mit Wurzeln außerhalb Deutschlands Hürden gibt, die ein Einheimischer nicht nehmen muss. Tradierte, vor allem mittelständisch geprägte Unternehmen gäben sich zum Teil verschlossen, wenn der Gesprächspartner der deutschen Sprache nicht mächtig sei. Dieser kleine Nachteil wird zu einem großen, wenn aus diesem Grund kein Geld fließt oder die Tür zu wichtigen Partnern verschlossen bleibt. Und Verbindungen seien wichtig, sagt Sirén. „Es gibt 100 Wege, um zu netzwerken. Aber es gibt keine Abkürzung.“ Soll heißen: Wer neu ist, muss viele Schleifen drehen, bis er ans Ziel kommt.
Diesen Beitrag lesen Sie auch in unserem Magazin diskurs Nr. 35. Bestellen Sie ein kostenloses Exemplar bei Roland Lis, Berater Privatkunden, Weberbank Actiengesellschaft, Tel.: (030) 897 98 – 403, E-Mail: roland.lis@weberbank.de